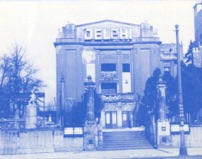Delphi, Berlin Location Bild & Clip weiter zurück
DELPHI
Delphi, der Tanzpalast, Kantstrasse 12a,
existiert von 1928 bis 1943. Architekt ist Bernhard
Sehring, der zuvor das Theater des Westens
erbaut hat. Das Delphi wird 1949 Filmpalast am Zoo,
Parkett 720, Rang 234 Plätze, Foyer mit Café.
Das Delphi befindet sich hinter dem Theater
des Westens, das heute zur Musical-Spielstätte mutiert ist.
Es überlebt als Premierenkino. Jeweils im Februar,
bei der Berlinale, ist es Spielort des Forum-Festivalprogramms.
Ein Jazz-Club und ein Kellertheater, das Quasimodo und
die Vaganten-Bühne. bespielen seit langem die Untergeschosse
des Delphi.
Das Haus mit Vorgarten, Kantstrasse 12a,
Berlin-Charlottenburg, Ecke Kantstrasse / Fasanenstrasse,
ist 1936 während der Olympischen Spielen das
Mekka der Swing-Fans.
„Und dann gab es natürlich noch die Original Teddies!“
trägt Hans Blüthner 1936 ins Tagebuch ein. „In diesem Sommer
des Berliner Olympiajahres hatte man eine reiche Auswahl
an echter Swingmusik, doch Stauffer wurde in der Werbung
überall an erster Stelle genannt.“ In Michael H. Kater,
Forbidden Fruit?
Teddy Stauffer und seine Original Teddies erlebt der
Banklehrling im Juli im Delphi dreimal, im September einmal und
im Oktober viermal. Im Tagebuch führt er Bandmitglieder
mit Namen und Instrumenten auf – was er bei keinem Orchester
sonst tut, wie Michael H. Kater vermerkt.
Im Delphi, auch unter freiem Himmel im Vorgarten, spielt
Teddy Stauffer mit seinen Original Teddies auf. Aber
es ist nicht nur die Musik, es ist Teddy Stauffer selbst, der mit
seiner Ausstrahlung, mit seiner Eleganz und Leichtigkeit
besticht. A ballet dancer. Schwerelos. Weiche Gesten. Androgyn.
Eröffnet hat das Delphi 1928 Josef König.
Der Gastronom lebt 1936 nicht mehr. Er ist 69jährig am 9.
September 1933 im Sanatorium Agra bei Lugano
in der Schweiz an den Folgen einer Lungenentzündung
gestorben.
Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 soll
ein Angestellter namens Williams, der sich als SS-Angehöriger
zu erkennen gibt, ihn mit Pistole bedroht und massiv
eingeschüchtert haben. Das Delphi hat König
seiner Lebensgefährtin Elfriede Scheibel und seinem Sohn
Wilhelm überschrieben. Im August 1936 ist Elfriede
Scheibel 35, Wilhelm 17 Jahre alt.
Knud Wolffram kommentiert in der Reedition Swinging
Delphi die Feststellung, dass das Delphi ausgerechnet
in NS-Parteiorganen wie Völkischer Beobachter und Das
Schwarze Korps für seine Veranstaltungen wirbt:
„Die Vermutung liegt nahe, dass hier eine Art Ablasshandel
betrieben wurde. Wir schalten regelmässig Anzeigen
bei euch, ihr lasst uns dafür in Ruhe.“
Fritz Hirzel, Delphi, Berlin.Teddy Stauffer 1936–1939.
282 Seiten, bebildert. Kaleidoskop. Paperback.
Zürich 2001.
Teddy Stauffer (in Es war und ist ein herrliches
Leben, Berlin 1968) erinnert sich:
„Die Olympiade brachte noch einmal die lllusion des
Friedens. Und für uns Musiker die lllusion künstlerischer Freiheit
in Deutschland. Die Amerikaner waren da. Ihre Anwesenheit
inspirierte uns im Delphi-Palast zu einem noch nie dagewesenen
Rhythmus. Man tanzte schon am Nachmittag Swing. Die
Abende waren von unbeschreiblicher Stimmung. Und mit den
Amerikanern tanzten die Berliner.“
„Natürlich gab es nicht nur Beifall, denn es gab
auch eine Menge verknorrter Nazis. Sie hassten unsere
,Juden-Musik´, und sie fanden es unerhört, dass ich
in Deutschland mit einem Orchester mit englischem Namen
auftrat. ,Deutscher – sprich deutsch!´ hiess ihre Parole.“
„Aber im Olympia-Jahr war die Reichsmusikkammer
grosszügig. Sie stellte mir ein von der Reichskulturkammer beglaubigtes Schreiben zu, worin mir ausdrücklich
erlaubt wurde, unter dem Pseudonym Teddy Stauffer's Original
Teddies aufzutreten.“
Der Brief – „Der Präsident der Reichsmusikkammer“ –
hat das Datum vom 7. August 1936. Er richtet sich an „Herrn
Teddy Stauffer, Berlin W, Kurfürstendamm 204“:
„Betrifft: Decknamen. Ihrem Vorschlag vom 2. 8. 36 entsprechend
habe ich keine Bedenken, wenn Ihre Kapelle in Deutschland
unter der Bezeichnung ,Teddy Stauffer mit seinen Original Teddies´ auftritt. Im Auftrage, gez. Wachenfeld.“ Mit Stempel
von Reichskultur- und Reichsmusikkammer.
Für Teddy Stauffer bedeutet das Gastspiel im Delphi
den Durchbruch.
„Zwar kannte man uns auch vorher schon in einigen
europäischen Städten. Jetzt aber, in Berlin, sassen
wir im Schaufenster der Welt. Jetzt wurden wir von einem
internationalen Publikum mit den grossen, international
anerkannten Orchestern verglichen.“
„Jetzt machten sich zehn Jahre harter Arbeit bezahlt:
Wir hatten uns zu einem guten Orchester zusammengespielt.
Und wir schnitten bei den Vergleichen hervorragend
ab. Der Delphi-Palast an der Kantstrasse war nachmittags
und abends überfüllt. Meistens drängten sich auf der
Strasse noch Hunderte, die keinen Einlass mehr fanden.“
Sieben Jahre sind vergangen, seit Teddy Stauffer
mit drei Teddies 1929 nach Berlin gekommen ist. In Amerika
wird der Swing lanciert, in Deutschland haben die Nazis
„die Macht ergriffen“. Teddy Stauffer gelingt es, die Marktlücke
zu besetzen, die vertriebene jüdische Musiker hinterlassen.
Er hat ein Tanzorchester aufgebaut, in dem 16 Musiker agieren.
Er hat es eingespielt. Er besetzt es um. Das Orchester
entwickelt sich.
Teddy Stauffer ist kein Solist, er ist „the leader of a swing
band“. Er hat ein Gespür für den Sound, der „in the air“
sein wird, er hat ein Flair für Broadway-, für Hollywood-Melodien.
Er selbst hat ursprünglich Violine gespielt, ein Instrument,
das aus dem Jazz gerade verschwindet.
(Teddy Stauffers Memoiren, Es war und ist ein herrliches
Leben, hat Fritz Langour verfasst, der verschiedenste
Bücher veröffentlicht, unter anderem auch einen Titel wie Naturheilkunde – Langour ist kein Swing-Fan, er ist
ein Hitlerjunge gewesen, bei der Reichspogromnacht 1938
ist er elfjährig.)